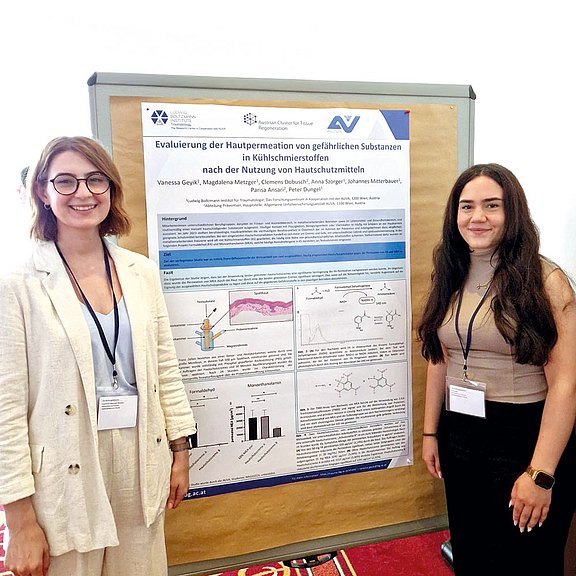Tatsächlich ist ein konkreter Wirknachweis bei Hautschutzcremen gesetzlich nicht vorgeschrieben, da Hautschutzmittel als Kosmetikprodukte gelten. Häufig stützen sich herstellende Unternehmen auf vereinfachte Prüfverfahren, etwa, indem sie eine Creme auf die Haut auftragen, anschließend eine Reizsubstanz applizieren und dann prüfen, ob es zu Rötungen oder anderen sichtbaren Hautveränderungen kommt. Bleibt die behandelte Stelle im Vergleich zur unbehandelten Haut unauffällig, gilt das Produkt als wirksam, unabhängig davon, ob es auch tatsächlich das Eindringen bestimmter Chemikalien in tiefere Hautschichten verhindert. Genau hier setzt ein aktuelles Forschungsprojekt am Ludwig Boltzmann Institut für Traumatologie, dem Forschungszentrum in Kooperation mit der AUVA, an.
Haut auf dem Prüfstand
Die Untersuchung wurde von der neu gegründeten Forschungsgruppe SHIELD durchgeführt, die unter der Leitung von Dr. Peter Dungel aus der früheren Arbeitsgruppe für Photobiomodulation hervorgegangen ist. Die Gruppe beschäftigt sich mit den Herausforderungen des modernen Arbeitslebens: Neue Technologien bringen neue Chemikalien, manche davon potenziell krebserregend, erbgutverändernd oder hormonell wirksam. Aber, wie die aktuelle Studie zeigt, auch herkömmliche Arbeitsstoffe oder deren Gegenmaßnahmen sind nicht immer ausreichend untersucht. Gegenmaßnahmen wären Hautschutzprodukte, die auf die jeweiligen Tätigkeiten des Berufs abgestimmt werden müssen, wie etwa im Friseurberuf, wo häufig Kontakt mit Wasser bzw. wässrigen Arbeitsstoffen stattfindet, die Verwendung eines wasserabweisendes Produktes. Ziel der Forschungsgruppe ist es, fundierte Daten zu generieren, um Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und wirksame Schutzmaßnahmen zu entwickeln.
Anna Szorger untersuchte in ihrer Masterarbeit, inwieweit zwei handelsübliche Hautschutzprodukte, die als geeignet für wasserlösliche und wasserunlösliche Arbeitsstoffe beworben werden, tatsächlich Schutz bieten. Für den Labortest wurde Schweinehaut, die menschlicher Haut in ihrer Beschaffenheit am ähnlichsten ist, in sogenannten Franz-Diffusionszellen eingespannt. Diese speziellen Apparaturen werden in der pharmazeutischen Forschung genutzt, um die Wirkstofffreisetzung und das Eindringen von Substanzen durch die Haut unter kontrollierten Bedingungen zu testen. Durch Verwendung dieser In-vitro-Methode können Tierversuche vermindert und neue Rezepturen von Salben oder Cremes kostengünstig getestet und verglichen werden. Die Franz-Zelle besteht aus einer Donor- und einer Akzeptorkammer, die durch eine Membran – in diesem Fall echte Haut – voneinander getrennt sind. Die Creme wird in die Donorkammer aufgetragen, während sich in der Akzeptorkammer ein wässriges Medium befindet, dem regelmäßig Proben entnommen werden.
Nach Eincremen der Haut wurden zwei Substanzen aufgetragen, die häufig in industriellen Kühlschmierstoffen vorkommen: Formaldehyd und Monoethanolamin. Formaldehyd selbst ist zwar in Reinform kaum noch enthalten, doch sogenannte Formaldehydabspalter – chemische Verbindungen, die langsam Formaldehyd freisetzen – werden weiterhin verwendet.
Die Forschenden entnahmen zu definierten Zeitpunkten Proben aus der Akzeptorkammer und machten den Gehalt der durchgetretenen Chemikalien mithilfe chemischer Reaktionen sichtbar. Das Ergebnis: Beide Cremes konnten das Eindringen von Formaldehyd deutlich reduzieren. Bei Monoethanolamin hingegen zeigte nur eines der beiden Produkte eine schützende Wirkung.
Mehr testen, besser schützen
„Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Hautschutzprodukte nicht automatisch universell wirksam sind, auch wenn sie entsprechend vermarktet werden“, erklärt Vanessa Geyik, MSc., die nach Szorgers Master-Abschluss deren Arbeit übernommen hat. Im ungünstigsten Fall könne ein ungeeignetes Produkt das Eindringen bestimmter Substanzen sogar ungewollt fördern. Die Studie liefert damit wichtige Anhaltspunkte dafür, dass bestehende Prüfverfahren überarbeitet und durch präzisere Testmethoden ergänzt werden sollten. Aktuell arbeitet das Team an einer Validierung der Ergebnisse mittels Ionenchromatografie, in Zusammenarbeit mit Dr.in Parisa Ansari Eshlaghi vom AUVA-Fachbereich Organische Chemie.
Hautschutz ist kein Nice-to-have, sondern ein zentraler Bestandteil des Arbeitnehmer:innenschutzes. Damit er wirklich wirkt, braucht es nicht nur gute Produkte, sondern auch gute Forschung – Forschung, die hinschaut, hinterfragt und dafür sorgt, dass Schutzversprechen auch gehalten werden. (cs)